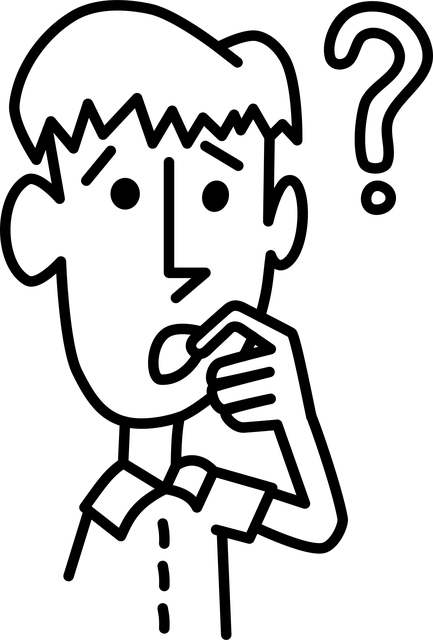Es gibt zwei mögliche Szenarien: Entweder wusste Christian Lindner schon im Oktober von dem ominösen „D-Day-Papier“ – was bedeuten würde, dass der FDP-Chef ein Faible für strategische Machtspiele hat und seit Wochen die Öffentlichkeit hinters Licht führt. Oder er wusste tatsächlich von nichts – was die spannende Frage aufwirft, wie sehr der Mann, der seit 2013 an der Spitze der Partei steht, überhaupt noch Kontrolle über seine eigene Mannschaft hat.
Das Thema wurde in der ARD-Talkshow „Caren Miosga“ am Sonntag ausgiebig durchgekaut. Lindners Antwort? Ein Klassiker: „Ich wusste von nichts.“ Die interne Kommunikation sei „ärgerlich“, der Begriff „D-Day“ unglücklich, und das Durchsickern des Papiers natürlich auch „ärgerlich“. Nur eine Sache ist laut Lindner nicht ärgerlich: sein eigenes Verhalten. „Ich übernehme die gesamtpolitische Verantwortung“, sagte er mit stoischer Ruhe, betonte aber gleichzeitig, dass er das Dokument nicht gelesen habe. Eine wahrhaft beeindruckende Demonstration von Verantwortung ohne tatsächliche Konsequenzen.
Dünnhäutiger Lindner unter Druck
Die Moderatorin Caren Miosga zeigte sich jedoch wenig überzeugt von Lindners Amnesie und bohrte weiter. Wie konnte es sein, dass der Generalsekretär ein solches Papier erstellt, ohne dass der Chef davon Wind bekommt? Lindner reagierte gereizt und schoss zweimal gegen die Moderatorin zurück: Sie würde mit ihrem „D-Day-Gefrage“ von den eigentlichen Problemen des Landes ablenken – wie der maroden Wirtschaft – und sei in ihrem Interview mit Robert Habeck (Grüne) letzte Woche viel sanfter gewesen.
Miosga ließ sich davon nicht beeindrucken und traf Lindner schließlich mit der Frage, warum er trotz der desaströsen Umfragewerte und diverser Wahlpleiten noch im Amt sei. Lindners Antwort: Er stehe zu seinen Überzeugungen, im Gegensatz zu Habeck oder Kanzler Olaf Scholz. „Meine Partei hat ihre Existenz in die Waagschale geworfen, um einen Richtungswechsel in unserem Land zu bewirken“, verkündete er mit pathetischer Miene. Dass die FDP bislang keine Neuwahlen ausgelöst hat und sich vor einem tatsächlichen „Richtungswechsel“ eher sträubt, ließ er dabei natürlich unerwähnt.
Die FDP und ihre Liebe zur Sparpolitik
Das Bürgergeld? Kürzen. Der Klimaschutz? Streichen. Migranten? Kein Geld mehr. Lindners Vorschläge klingen wie aus einem AfD-Workshop entlehnt. Doch er stellt klar: Die FDP wolle niemanden „aus dem Land fegen“, wie es extreme Rechte fordern würden. Sie wolle lediglich die Sozialausgaben straffen und den Haushalt sanieren – mit Ideen, die selbst Ökonomen für fragwürdig halten.
Während der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, anmerkte, dass Deutschland dringend mehr Geld in Infrastruktur und Verteidigung investieren müsse, blieb Lindner stur: Schuldenaufnahme sei ein Tabu. Stattdessen schlug er vor, die soziale Lage zu verschlechtern, indem er pauschale Wohngelder und Kürzungen beim Bürgergeld durchsetzt. „Die Leute können ja arbeiten“, meinte er trocken. Ein Vorschlag, der weder Quadbeck noch die Sozialrealität beeindruckte: Viele Menschen arbeiten bereits und verdienen dennoch nicht genug.
Der „D-Day“ der FDP: Realität oder Theater?
Ob Lindner tatsächlich die Strippen im Hintergrund gezogen hat oder einfach nur nichts mitbekommt, wird wohl ein ungelöstes Mysterium bleiben. Was jedoch klar ist: Lindner plant, die FDP weiterhin anzuführen – und zwar als Spitzenkandidat bei der nächsten Bundestagswahl. Ein gewagtes Unterfangen, angesichts von Umfragewerten, die so niedrig sind wie das Vertrauen in die deutsche Bahn.
Sollte die FDP tatsächlich an der Fünfprozenthürde scheitern, droht eine parteiinterne „offene Feldschlacht“, die möglicherweise spannender wird als jede Talkshow. Aber bis dahin wird Lindner vermutlich weiter mantraartig betonen, dass er von allem nichts wusste, außer von seiner eigenen Brillanz.