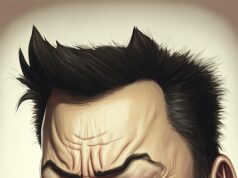Die Grundidee klingt eigentlich simpel: Die Länder, die die Klimakrise maßgeblich verursacht haben, sollen jene unterstützen, die am stärksten darunter leiden. Doch in der Praxis wird aus dieser vermeintlichen Einigkeit ein altbekanntes Spiel: Wer zahlt? Warum? Wie viel? Und vor allem – wofür?
Willkommen bei der COP29 in Baku, wo Verhandlerinnen und Verhandler aus aller Welt erneut versuchen, den Planeten zu retten, während sie gleichzeitig auf ihre eigenen nationalen Budgets starren. Das aktuelle Ziel von 100 Milliarden US-Dollar jährlich läuft 2025 aus – und die Forderungen sind, wie zu erwarten, inzwischen in den Billionenbereich gewachsen. 1,3 Billionen Dollar pro Jahr stehen im Raum. Doch wer soll das bezahlen?
Die große Schuldzuweisung
„Die Klimafinanzierung ist keine Frage der Solidarität, sondern eine Verpflichtung“, erklärt der österreichische Klimaexperte Martin Krenn. Übersetzt bedeutet das: Reiche Staaten sollen endlich ihre Rechnung begleichen. Schließlich haben sie den Großteil der historischen Emissionen zu verantworten. Klingt moralisch einwandfrei – doch während Entwicklungsländer, allen voran Inselstaaten, verzweifelt auf Unterstützung pochen, streiten sich die großen Volkswirtschaften darum, wer überhaupt als „reich“ gilt.
Definiert nach 1992 – aber bitte mit Update
Die Definition, welche Länder als Industrienationen gelten, stammt noch aus dem Jahr 1992. Damals war die Welt noch vergleichsweise übersichtlich: Die EU, die USA, Kanada und Australien trugen den Löwenanteil an den Emissionen. Aber heute? China und Saudi-Arabien gehören längst zu den größten Emittenten. Die „alten Industrienationen“ fordern daher, dass der Kreis der Geldgeber dringend erweitert werden müsse. Schließlich sei es unfair, wenn nur sie allein die Rechnung tragen sollen, während China und Co. fröhlich weiter Kohle verfeuern.
Billionen statt Milliarden – ein neues Ziel?
Doch alle Beteiligten – ob mit Blumen im Haar oder Krawatte um den Hals – scheinen sich zumindest auf eine Sache einigen zu können: Die 100 Milliarden Dollar reichen hinten und vorne nicht. Und so steht die Herkulesaufgabe, ein „New Collective Quantified Goal on Climate Finance“ (NCQG) zu definieren, im Zentrum der Verhandlungen.
1,3 Billionen Dollar jährlich – das fordern die Entwicklungsländer von den Industrienationen. Davon sollen 300 Milliarden für den Klimaschutz, 300 Milliarden für Anpassungsmaßnahmen und satte 400 Milliarden für die Bewältigung von Schäden und Verlusten bereitgestellt werden. Martin Krenn erinnert dabei nachdrücklich daran, dass Kredite hier keine Lösung seien: „Es bringt nichts, Schuldenberge in ohnehin schon finanziell schwachen Ländern weiter wachsen zu lassen.“
Wer zahlt die Party?
Die Industrieländer wiederum schieben den schwarzen Peter hin und her. Schließlich läuft auch ihr Geld nicht über. Klimaschutz ja, aber bitte ohne die Wirtschaft zu belasten – eine Argumentation, die vor allem bei denjenigen gut ankommt, die weiterhin kräftig in fossile Brennstoffe investieren. Ironischerweise fließt heute mehr Geld in fossile Subventionen als in Klimafinanzierung.
Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) formuliert es diplomatisch: „Sie werden von mir keine Zahl hören.“ Gut, dass sie das gleich klarstellt. Der Konsens scheint zu sein, dass kein Konsens existiert.
Die Forderung nach Allianzen
Doch mitten im Getümmel der Verhandlungen wird der Ton schärfer. Greenpeace und andere NGOs fordern mehr Einsatz von Ländern wie Österreich und der EU. „Zahlt endlich für die Schäden und Verluste“, steht auf Transparenten, während Klimaaktivistinnen in Baku mit erhobenen Schildern auf den Straßen protestieren.
„Die Gräben müssen zugeschüttet werden“, appelliert Jasmin Duregger von Greenpeace. Die Uhr tickt, und ohne einen umfassenden Finanzierungsplan drohen die Klimapläne im globalen Süden zu scheitern. Aber wer wird der erste sein, der wirklich eine Brücke baut?
Schlussfolgerung: Geld ist nicht alles, oder doch?
Die Wahrheit ist: Ohne Milliarden oder besser noch Billionen wird es keine Klimagerechtigkeit geben. Doch während die Länder des globalen Nordens und Südens um die Verantwortung streiten, wird eines immer deutlicher: Das Klima wartet nicht. Und je länger die Finanzierung stockt, desto größer wird der Preis, den alle zahlen müssen.